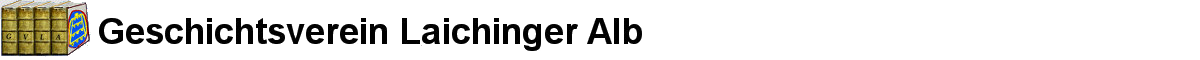Daniel Mangold (1853 - 1935)
(Heinz Surek, Laichingen)Am 13. Januar 1935 ist in Laichingen ein einfacher Mann gestorben: ein Leinenweber, wie es so viele im Flecken gab, und ein Poet dazu. Wenig diesseitige Hoffnungen hatte er, aber ein um so volleres Herz, und aus der Fülle seines Gemüts flossen ihm mitunter Reime und Verse zu, die uns bis heute erfreuen und nachdenklich stimmen.
Von früh bis spät saß er, der Weber Daniel Mangold, in der Dunk, dem engen Webkeller des kleinen Hauses in der Weberstraße, das von vier Familien bewohnt war; und dann konnte es bisweilen vorkommen, dass der Webstuhl plötzlich stillstand und Daniel Mangold versonnen auf etwas hörte, was nur er vernehmen konnte. Von irgendwoher kramte er ein Fetzlein Papier hervor, legte es auf den Webstuhlbalken und kritzelte ein paar Verse darauf, etwa diese:
Fliege, Schifflein, rastlos fliegeDann aber konnte es geschehen, dass über dem dichtenden Weber die Dunkfalle sich öffnete, eine scharfe Frauenstimme ihn aus seinen Träumen riss und zur weiteren Arbeit antrieb. Wieder begann der Webstuhl zu schlagen und zu klappern, eintönig und traurig, und traurig blieb der letzte Vers in des Webers Kopf, bis er ihn in einer stillen Stunde aufschreiben konnte:
Deine vorgeschriebne Bahn
Eil mit Weile, aber eile,
So kommst du am Ziele an.
Blatt, erklirre in der Lade,
Sing ein Lied zu jedem Schlag
Von der Flüchtigkeit des Lebens
Und wie rasch es enden mag.
Geht ihr Schäfte auf und nieder
Wie die Wogen in der See.
Ach, so wechseln frohe Stunden
Mir noch oft mit trübem Weh!
Halt! Die Spul' ist abgelaufen,Mangolds Dichtkunst konnte sich nur unter großen äußeren Schwierigkeiten entfalten. Er hat sich oft gefragt, ob es nicht besser wäre, diese Gabe zu unterdrücken und zu verleugnen. Sein äußeres Leben wäre dann einfacher gewesen, und doch wäre er ohne sein entsagungsvolles Dichtertum noch ärmer geworden. Und so bekannte er sich trotz allem zu seiner "lieben Poesie", erhob sich mitunter über sein ärmliches Dasein und wanderte im Geiste über so manchen Grat, auch wenn er selbst höchst selten seinen Fuß über die Laichinger Markung hinaus gesetzt hat.
Und es steht der Webstuhl still.
Endet friedlich nur mein Leben,
End' es, wie und wann Gott will!
So du nicht kannst dein eigen IchMit diesen Worten beginnt Daniel Mangolds Gedicht "Dichters Los", und an diesem Los hatte er mitunter allzu schwer zu tragen. Weder seine Frau noch die Bekannten hatten Verständnis für sein Tun; mit niemandem konnte er sich geistig austauschen. Der Weber in der feuchten Dunk war ja oft bis zu zwölf Stunden täglich mit sich und seiner Arbeit allein, nicht einmal ein Blick auf die Straße war ihm vergönnt. Somit ist es nicht verwunderlich, dass viele Laichinger Weber den Weg nach innen suchten, ins Sinnieren, Grübeln und bisweilen ins Spintisieren gerieten. Das laute und lärmerische Wesen lag den Laichinger Hauswebern ohnehin nicht. Zur unteren sozialen Schicht in der strenggegliederten Ortshierarchie gehörend, hatten sie nirgendwo viel zu bestellen. Eine damals oft gehörte Redensart lautete: "Bei de Herre und de Baure, hot a Weber nix verlaure." Daran mag auch Daniel Mangold gedacht haben, als er seinen köstlichen "Rabenspruch" verfasst hat:
In dir zertrümmern und zerschlagen
Und ganz und gar vergessen dich
Und deinen Schmerz zu Grabe tragen,
Ist dein Gemüt nicht frei und licht,
Dass sich drin spiegeln Welt und Leben,
Bist du ein echter Dichter nicht,
Wirst du das Höchste nie erstreben.
Solange noch die RabenDer äußere Lebenslauf des Menschen Daniel Mangold ist rasch erzählt, zumal das Aufzählen der Lebensdaten und -stationen eher dürftig ausfällt. Er kam am 3. Oktober 1853 im wohl ärmlichsten Weberviertel Laichingens zur Welt, und zwar im gleichen Weber- und Bauernhaus in der Weberstraße, in dem er am 13. Januar 1935 gestorben ist. Dazwischen liegen 82 Jahre eines entsagungsvollen Weberdaseins, das nur wenige Höhepunkte zu verzeichnen hat. Längst war die Zeit für die Laichinger Hausweberei ungünstig geworden. In anderen Weberstädten, wie Urach, Blaubeuren und Heidenheim liefen im ausgehenden 19. Jahrhundert bereits mechanische Webstühle, mit denen ein Vielfaches dessen produziert wurde, was in den Laichinger Dunken geschaffen werden konnte. Trotzdem hielt auch Daniel Mangold verbissen und eigensinnig an der jahrhundertelang praktizierten Hausweberei fest - was blieb ihm auch sonst übrig? Bereits in der Schule fielen dem Lehrer und dem Pfarrer der wache Geist des Weberkindes auf, und man riet dem Vater, seinen Sohn auf eine höhere Schule zu schicken. Allein die Armut im Weberhaus war so groß, dass es Johannes Mangold unmöglich erschien, seinen Daniel einen geistigen Beruf erlernen zu lassen. Nicht einmal auf das Landexamen durfte er sich vorbereiten, das ihm die Aufnahme in ein evangelisch-theologisches Seminar erlaubt hätte. Trotzdem versäumte es der Pfarrer nicht, ihn zu mancherlei Gesprächen in sein Haus zu holen, und ihn aus dem Schatz seiner Bibliothek immer wieder mit Lesestoff zu versorgen. Auf diese Weise lernte der Heranwachsende die deutschen Klassiker, allen voran Friedrich Schiller, und die Philosophen des Altertums kennen, wobei ihn Platons Schriften am meisten fesselten. Die Pfarrersbuben freundeten sich mit ihm an, und er machte auch die Bekanntschaft ihrer Studiengenossen; unter ihnen befand sich der spätere Tübinger Dekan Eduard Gmelin und Paul Dorsch, der nachmalige Herausgeber des evangelischen Sonntagsblattes. Diese, seine Jugendfreunde, nahmen ihn auch mit nach Tübingen, damit er dort mit Erlaubnis der Professoren als Gast Vorlesungen über Theologie und Philosophie hören konnte. Ja, mitunter begab sich Daniel Mangold zu Fuß von Laichingen in die Universitätsstadt am Neckar, um seinen Bildungsdrang zu stillen. Mit wachem Interesse besuchte er die Vorlesungen des Theologen Emil Kautzsch, der als unumstrittene Koryphäe auf dem Gebiet des Alten Testaments galt, und des Philosophen Christoph Sigwart. Die Tübinger Zeit endete aber jäh und abrupt. Da er kein anderes Gewand hatte als seine bäuerliche Kleidung, saß er im Blauhemd im Hörsaal. Hochmütige Studenten machten sich deshalb über ihn lustig und verspotteten den armen Älbler. Daniel Mangolds empfindsamer Stolz wurde dadurch derart verletzt, dass er postwendend den Heimmarsch antrat und fortan der Universität fernblieb. Hinzu kam noch die Krankheit des Vaters, so dass Daniel zwangsweise das winzige bäuerliche Anwesen der Eltern und seinen Platz am Handwebstuhl in der Dunk einnehmen musste. Zeitlebens hat er dieses Schicksal beklagt, wenn auch bisweilen hintersinnig und allegorisch wie in folgendem Gedicht:
Den ersten Ton hier haben,
Braucht keiner sich bemühen
Mit eignen Melodien.
Mit Krächzen und mit Schreien
Die Vöglein sie bedräuen:
"Was soll der Singsang hier?
Schweigt! Oder singt wie wir!"
"Warum", so sprach der Esel einst,Daniel Mangold fügte sich in das Unvermeidbare und nahm das Los des Säcke tragenden "Esels" an. In der Arbeit am Webstuhl und auf dem Feld fand er zwar keinen Ersatz für geistige Betätigung, aber doch eine gewisse Befriedigung und Erfüllung im schweren Erdendasein. Ja, die Arbeit, die ihm wenigstens das Nachdenken über geistige Dinge ermöglichte, half ihm über manches hinweg, wie er es in seinem "Lob der Arbeit" treffend formulierte:
"Muss ich denn die Säcke tragen,
Darf ich denn nicht wie ein Pferd
Durch die Welt hin jagen?
Hab ich doch vier Beine auch,
Augen zwei und Ohren,
Bin doch auf die gleiche Art
Wie das Pferd geboren!"
"Aber", sagt das Kutschenpferd,
"Kannst nur Disteln fressen!
Reichten sie den Hafer dir,
Wärst du rasch besessen!
Du zerschlügest Strang und Rad
An dem schönen Wagen!
Darum bleibt es gut für dich,
Täglich Säcke tragen!"
Wenn ich wüsste, dass schon morgenFreilich, so leicht fiel es Daniel Mangold nicht, sich mit der körperlichen Arbeit abzufinden und zufriedenzugeben. Bisweilen entzündete sich sein Gemüt am Unverstand seiner Umgebung, setzte zu Höhenflügen an, die bald von der rauen Wirklichkeit vereitelt wurden. Dann ertränkte er manchmal die seelische Last stolz und einsam im Glase, bis er auch dies wieder ließ und mit der ihm gemäßen Art den Schmerz besiegte, den Schmerz, der in den meisten seiner Gedichte als Klage ausgedrückt wird:
Pochte an die Tür der Tod,
Wollt' ich doch noch heute ringen
Tapfer mit des Lebens Not.
Feierabend soll mir werden,
Wann ich ruh im Schoß der Erden.
Arbeit war mir oft im Leben
Balsam gegen herbes Leid,
Zuflucht, wenn mich hart bedrückte
Allzu rau die Wirklichkeit.
Der Verdrossenheit Gedanken
Brachen an der Arbeit Schranken.
Unser aller Erdenleben
Würde kaum erträglich sein,
Wär' uns Arbeit nicht gegeben,
Arbeit bis zum Totenschrein.
Ob auch Gram das Herz erfülle,
Arbeit macht zuletzt es stille.
Drum so will ich fröhlich wirken
Eh' sie kommt, die lange Nacht,
Treu auf meinem Posten stehen,
Bis das Tagwerk ist vollbracht.
Bis ich darf von Erdenmühen
Frei zur andern Heimat ziehen.
Einsam, immer gern allein,Daniel Mangold war aber nicht nur der grüblerische und sinnierende Einzelgänger, als der er seinen Gedichten zufolge erscheinen mag. Wenn man ihm auf seinen ausgedehnten Spaziergängen an den Sonntagen draußen im Feld begegnete und ihn ansprach, konnte er zutraulich, mitteilsam und humorvoll sein. Man konnte ihn auch auf seine Gedichte ansprechen, die immer wieder in der Heimatzeitung abgedruckt wurden. Eines von ihnen allerdings hat er zunächst gar nicht, und später nur widerstrebend zur Veröffentlichung freigegeben. Man hätte ihn danach auch nicht fragen dürfen, weil es einen Schmerz ausdrückt, den er zeitlebens nicht überwinden konnte:
Ging ich durch das Leben.
Frühe schon der Einsamkeit
War mein Herz ergeben.
Zwar die Menschen liebt auch ich,
Grüßte froh und heiter
Jeden, der vorüberging,
Wartend schritt ich weiter.
Fand ich wo ein zart Gemüt,
Edlem aufgeschlossen,
Hab ich gerne es erwählt
Mirs zum Weggenossen.
Fielen die Gefährten ab,
Hab ichs still ertragen,
Wo es mein Geschick gewollt,
dass ich sollt entsagen.
Manchem war ich allzu fromm,
Viel zu weltlich andern,
Sehr vergnüglich war es nicht,
So die Welt durchwandern.
Drum der stillen Einsamkeit
Blieb mein Herz ergeben,
Und der lieben Poesie
Weihte ich mein Leben.
Ich dachte dein, es war um Mitternacht,Sein ganzes Leben hat Daniel Mangold an einer zerbrochenen Liebe gelitten, und diese innere Not drückte schwerer als die äußeren Sorgen ums tägliche Dasein. Seine Angebetete hat dann, vielleicht dem Druck der Eltern nachgebend, einen älteren und reichen Bauern im Ort geehelicht, und Daniel Mangold musste zusehen, wie seine oft besungene Liebste mit ihrem "Mann in grauen Haaren" nicht glücklich wurde, sich nicht entfalten konnte, sondern vielmehr seelisch verkümmerte, so wie Mangold es in seinem Gedicht "Verlorenes Lieb" vorausgesehen hat:
Wo Sehnsucht, Krankheit nur und Sorge wacht.
Vorüber ging der edlen Toten Schar,
Mit welchen einst mein Herz verbunden war.
Du lebtest noch - doch in der Toten Reihn
Fügte dein Bild, dein liebes, auch sich ein.
Dein Auge ruhte auf mir unverwandt,
Ein Sehnsuchtsblick, wie ich ihn oft gekannt.
Und doch so ruhig, doch so todeskalt,
Tief fühlt ich seine zwingende Gewalt.
Mir ward bewusst: Du willst vergessen sein,
Und doch bringt mein Vergessen dir noch Pein.
Weil du noch stehest in der Liebe Bann,
Weil noch die Seele sich nicht lösen kann.
Du kamst zu mir wohl in der Toten ernsten Reihn
Und willst in mir doch nicht gestorben sein.
Weil du es fühlst, dann ist dein Leben vollends leer -
Wie er geliebt, so liebt mich niemand mehr.
Die Hochzeitsglocken klangenNach dieser bitteren Enttäuschung wählte Daniel Mangold, mehr aus Trotz als aus Liebe, Apollonia Laichinger zur Frau. Die Hochzeit fand am 7. Mai 1885 statt. Die beiden haben dann keine gute Ehe geführt; zu verschieden waren sie in ihren Wesenseigenschaften, in ihren religiösen und sonstigen Auffassungen. Alles, was er nun dichtend schuf, musste er heimlich tun. Oft genug hat seine Frau seine Gedichte und dramatischen Skizzen in geradezu sträflicher Verblendung verbrannt, wenn sie ihrer habhaft wurde. In ihren Augen war dies alles wertloses Zeug, wenn nicht gar Anmaßung und Versündigung. Sicherlich tat die Not im Weberhaus das Ihrige dazu. Jede Minute, die nicht dem Broterwerb diente, war für Frau Mangold verloren und vertan. Sie entrüstete sich über die scheinbare Gleichgültigkeit des Mannes, der, wenn kein Papier im Hause war, schon mal den weißen Rand der Heimatzeitung mit unnützen Verslein vollschrieb. Sicherlich tat es ihr auch weh, dass die Liebe ihres Mannes immer noch einer anderen gehörte, die ebenfalls im Ort lebte und die sie kannte. Auch von der religiösen Richtung der "ernsten Bibelforscher", zu der sich Frau Apollonia hingezogen fühlte, wollte Daniel Mangold nichts wissen. So wurde diese Ehe für beide Partner zum Martyrium - wer aber wollte hier Schuld zuteilen? Und wenn auch viele Laichinger die Gedichte ihres Landsmannes unbeachtet ließen, die eine Strophe aus dem "Rosenstrauch" zitierte man gern, und bisweilen nicht ohne Häme:
Vom alten Turm herab
Die Hochzeitsglocken klangen,
Wohl weiß ich
dass sie sangen
Ein Liebesglück zu Grab.
Als ich den Zug gesehen,
Inmitt die blasse Braut,
Als ich den Zug gesehen
Vorbei am Fenster gehen,
Da hat es mir gegraut
Und als sie zugetrunken
Dem Bräutigam so stumm,
Als sie ihm zugetrunken,
In tiefes Weh versunken,
Wusst ichs gar wohl ... warum.
Der Mann in grauen Haaren,
Ob er sie glücklich macht?
Der Mann in grauen Haaren,
So kalt, so welterfahren,
Ob ihm ihr Herz je zugelacht?
Weil es denn doch geschehen
Und keine Hoffnung blieb,
Weil es denn doch geschehen,
Will in die Welt ich gehen,
Leb wohl, leb wohl, mein Lieb!
Uns ging es wie dem RosenstrauchTrotz allem drang auch in Mangolds enges Haus in der Weberstraße bisweilen der Sonnenschein ein. Dies war sicherlich der Fall, als am 15. Juli 1886 den Eheleuten eine Tochter, die Barbara, geboren wurde. Zwei Jahre später folgte Sohn Johannes. Insbesondere an seinem Hans hat Daniel Mangold viel Freude gehabt. Was dem Vater versagt geblieben war, sollte dem Sohn zuteil werden: eine Ausbildung zu bekommen, die seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprach. So erlernte Hans Mangold zunächst das Musterzeichnen in der Laichinger Webschule, besuchte dann ein Jahr lang das Technikum in Reutlingen, studierte an den Maschinenbaufachschulen in Stuttgart und Cannstatt und arbeitete schließlich als Konstrukteur in den Daimlerwerken in Untertürkheim. Er hatte übrigens viel vom Vater: die Ernsthaftigkeit, das Grüblerische, wohl auch einen Hang zum Magischen und Mystischen und die Empfindung, kommende Dinge erahnen zu können. So hat er den Kriegskameraden bei den Kämpfen um Bozan an der Narew im Jahre 1915 seinen Soldatentod mehrmals vorausgesagt, verschwieg dies aber in seinen Briefen an die Eltern. Der Vater indes ahnte ein Gleiches, ließ aber natürlich seinen Hans davon nichts wissen. Als dann am 25. Juli 1915 Daniel Mangolds einziger Sohn durch einen Kopfschuss getötet wurde, hat ihm der Vater in der Laichinger Heimatzeitung einen ergreifenden Nachruf gewidmet:
Mit unsrem flücht‘gen Lieben,
Die Rosen nahm der kühle Hauch,
Die Dornen sind geblieben.
Schlaf wohl, mein Sohn, im fernen Russenland -Von da an wurde Daniel Mangold noch stiller und in sich gekehrter. Es gab Tage, da war er überhaupt nicht ansprechbar. Die Gedichte der nun folgenden Jahre sind schwieriger zu verstehen, sie drücken aber auch eine Frömmigkeit aus, wie sie weder in der Kirche noch in den Laichinger "Stunden"-Versammlungen am Sonntagnachmittag gelehrt wurde. Mangold hielt zwar fest an den christlichen Glaubensinhalten, wie sie die Kirche verkündete, entwickelte sie aber als schwäbischer freigeistiger Sinnierer in spekulativer Weise weiter, wobei er insbesondere pantheistische Vorstellungen des Mystikers Jakob Böhme, mit dem sich Daniel Mangold intensiv beschäftigt hat, seinem Welt-, Gottes- und Menschenbild zugrunde legte:
Im Heldengrab am düstern Narewstrand.
Schlaf wohl, mein Sohn, für dich ist er vorbei,
Der harte Kampf, und ewig bist du frei!
Wir aber stehen noch in trübem Leid,
Wie's uns gebracht die grauenhafte Zeit;
Stets klingt im Herzen uns dein Abschiedswort,
Bis dass wir selbst auch ruh'n am letzten Ort.
Im Geiste schauen wir dein liebes Bild,
So oft des Heimwehs stille Träne quillt -
Und doch, es ist, als riefest du uns zu:
"Seid nicht so traurig, gönnt mir meine Ruh!
...
Was sich in Gott geliebt, scheidet kein Tod,
Nicht der Verwesung düstres Morgenrot;
Ein Tag bricht an, siegreich wird auferstehn
Die Saat, von Gott gesät in Kriegesweh'n!"
Schlaf wohl, mein Sohn, im fernen Rußenland,
Bei Szarlatt an des Narews Strand!
Die Wellen singen dir dein Schlummerlied
Und werdens dir zu singen nimmer müd!
Und Blümlein blüh'n wohl auch auf deinem Grab,
Wie Gottes Güte immer Blumen gab
Auf Heldengräber auch auf blut'ger Au,
Gepflegt, begossen von des Himmels Tau:
Dass sie nicht allzusehr verödet steh'n -
Schlaf wohl, mein Sohn! Auf frohes Wiedersehn!
Ich glaub' an einen Gott, der alle Welt durchgeht,Daniel Mangolds Gedichte sind sicherlich kleine sprachliche Kunstwerke, auch wenn sie in Form und Aufbau einfach und schlicht, ja beinahe kunstlos gestaltet sind. So bevorzugt er in der Regel Paar- und Kreuzreime, selten einen umschließenden Reim. Auch im Versmaß dominieren einfache Jamben und Trochäen. Worin liegt also das Geheimnis, dass Mangolds Lyrik uns auch heute noch anspricht und Saiten in uns zum Schwingen bringt? Es ist wohl das ehrliche Ausdrücken des tief innen Erlebten und Erfahrenen; nicht um Worte ging es ihm, sondern um die Fragwürdigkeit menschlichen Strebens und den Blick auf das eigentlich Wichtige. Und dieses Eigentliche suchte er bei den Mitmenschen, und er suchte es in seinem beachtlichen Bücherbestand. Er wird es wohl eher draussen bei seinen weiten Gängen durch die hügelige Laichinger Alblandschaft gefunden haben, und er hat wohl dort in der Einsamkeit seine besseren Augenblicke erlebt, in denen er Gott ganz nahe war.
Der jeden Raum durchdringt, wie uns die Luft umweht,
Und dass er ist der Geist und Schöpfer der Natur,
Ihr selbst nicht untertänig wie Mensch und Kreatur.
Ich glaube, dass der Mensch dem Leibe nach als Staub,
Doch dass sein Geist und Gott ein unvergänglich Laub,
dass Gott im Tode ihm das Selbstbewusstsein weckt,
Ob auch die Hülle Grab und Moderstaub bedeckt.
Ich glaube, dass die Zeit, in der die Welt besteht
Von Gott gemessen ist und dass sie einst vergeht,
Wenn Gott in Trümmer schlägt, das was er selbst erbaut,
Weil eine bess're Welt sein gütig Auge schaut.
Ich glaube, dass ans Ziel die Menschheit kommen wird,
Ans hohe lichte Ziel, wie oft sie auch noch irrt,
Noch oft von Gott sich wendet, sich selber Weihrauch streut,
Auch dieses geht vorüber - Zeit ist nicht Ewigkeit.
Wilde Rosen, SchwarzdornblütenDaniel Mangold hat auch dramatische Werke verfasst, von denen allerdings nur drei der Nachwelt erhalten geblieben sind. Im Jahre 1894 entstanden die "Lore" und "Leonor de Cisneros", und es waren vor allem diese volkstümlichen Dichtungen, die Mangold auch in seiner Heimatgemeinde Anerkennung verschafft haben. Als im Jahre 1922, also 28 Jahre nach ihrer Entstehung, die "Lore" in Laichingen uraufgeführt wurde, war Mangold zum ersten Mal als Dichter publizistischer Erfolg beschieden. Literarische Fachzeitschriften waren auf ihn aufmerksam geworden, und in mancher Abhandlung wurde sein dichterisches Schaffen gerühmt. Nun häuften sich auch die Besuche von literarisch Interessierten beim Volks- und Weberdichter in Laichingen, und nun konnte zum ersten Mal, mit Hilfe des Erlöses aus der "Lore"-Aufführung und mit Unterstützung der Gemeinde, ein bescheidenes Bändchen mit "Ausgewählten Dichtungen" veröffentlicht werden, dem im Jahre 1954 eine weitere kleine Gedichtesammlung folgte. Zwei Jahre nach der "Lore" wurde ein weiteres Bühnenstück von Daniel Mangold, "Gertrud von Weistetti", in Laichingen uraufgeführt. Eine "dramatische Skizze", so nannte der Verfasser sein Heimatschauspiel, das im ausgehenden Mittelalter auf der Laichinger Alb spielt und das, ebenso wie die "Lore", das Motiv der entsagenden Liebe behandelt. Sein wohl reifstes dramatisches Werk ist das lange Zeit verschollen gebliebene Stück "Leonor de Cisneros", das vor allem durch seine Gedankentiefe beeindruckt und durch seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit überrascht, die sich die Klassiker zum Maß genommen hat. Ort der Handlung ist Spanien, wo im 16. Jahrhundert die Anhänger des Protestantismus durch die Inquisition erbarmungslos verfolgt, gefoltert und hingerichtet werden. Auch hier kann sich die reine und makellose Liebe zweier Menschen auf Erden nicht entfalten. Auch das Todesurteil kann Leonors Standhaftigkeit und Treue nicht erschüttern, und wie die Lore und die Gertrud, die Heldinnen der anderen Dramen Mangolds, erfährt und praktiziert auch sie jene Liebe, die über den Tod hinausreicht und auf Gott hinweist:
Silberdisteln, Enzian,
Farrenkraut und Zittergräser,
Ehrenpreis und Löwenzahn,
Nur benetzt vom Tau des Himmels,
Nie gepflegt durch Menschenhand:
Solchen Strauß nur kann ich binden,
Weil ich bessern keinen fand.
Nehmt vorlieb! Ein Strauß vom Felde,
Ohne Wahl und hohe Kunst,
Mög er doch ein Herz erfreuen,
Dargereicht durch Gottes Gunst.
Denn nur, wer völlig rein und frei,Bei aller Anerkennung der dramatischen Versuche Daniel Mangolds, von denen er vieles selbst wieder vernichtet hat, ist doch das Eigentliche und Wesentliche in seiner Lyrik zu suchen. Sie drückt im wahrsten Sinne des Wortes verdichtet die innere Zerrissenheit und Widersprüchlichkeit eines Menschen aus, aber auch seine Sehnsucht nach Seelenfrieden, die ihn zeitlebens, oft bis in seine Träume hinein, begleitet hat:
Darf sich Dein eigen nennen.
Wie schwach er noch im Glauben sei,
Dich auch im Tod bekennen:
So es Dein Will' aus Kampf und Leid
Heim gehn zu Dir, in Ewigkeit.
Mir träumte einst ein wirrer TraumMan hat in Laichingen anlässlich des 100. Geburtstages Daniel Mangolds eine Straße nach ihm benannt, und man hat auch recht daran getan, seinen Grabstein auf dem Friedhof am ursprünglichen Ort zu belassen und ihn zu restaurieren, damit die "Trübe Ahnung" des Laichinger Weberdichters sich nicht bewahrheite:
Von wildem Hass und Lieben,
Von Sehnsucht, innigem Umfahn
Und tödlichem Betrüben,
Von Rosen rot und Lilien weiß,
Von frischem Myrthenkranze,
Von heißer Lust, von stillem Glühn,
Von wildem Reigentanze.
Da wusst ichs, dass es ein Idol
Der wahren Liebe gebe,
Das, weil es nicht vom Himmel stammt,
Auch nie zum Himmel strebe.
Und wieder träumt ich einen Traum
Von idealem Lieben,
Und dennoch wars nur bunter Schaum,
Ein funkelnder, doch leerer Traum,
Das Ende - tief Betrüben.
Wie wollt ich so vergessen ganz
Im lieben Du mein Leben?
Weh mir, der Selbstverleugnung Kranz,
Trotz Ideal und Duft und Glanz
Ward kühl zurückgegeben.
Drum ist die Lieb nicht Tag noch Nacht,
Sie gleicht der Morgenröte,
Wenn eben erst der Tag erwacht,
Ein Leuchten, das glückselig macht,
Wie Andacht im Gebete.
O dass am Abendhimmel mir
Eh noch mein Tag geschieden,
Eh noch die Nacht tritt aus der Tür,
Ihr wunderbares Leuchten mir
Noch einmal strahl im Frieden.
O Wald, dein leuchtend Frühlingsbild,Vielmehr soll das Gedenken an diesen bemerkenswerten Mann nicht verloren gehen, und es möge sich für uns alle erfüllen, was auch seine Hoffnung war:
Werd ichs noch einmal sehen?
Ach, bis sich dir dein Traum erfüllt,
Was mag mit mir geschehen?
Hoffnung, Hoffnung, sel'ge Christenhoffnung,
Die auch über Gräbern triumphiert.
Nimmer lässt du den zuschanden werden,
Der dich aus dem Herzen nicht verliert.